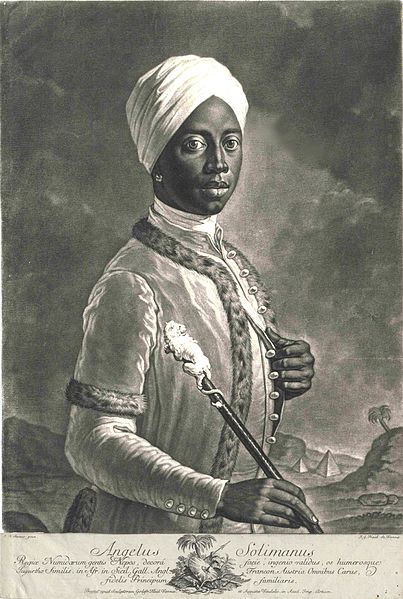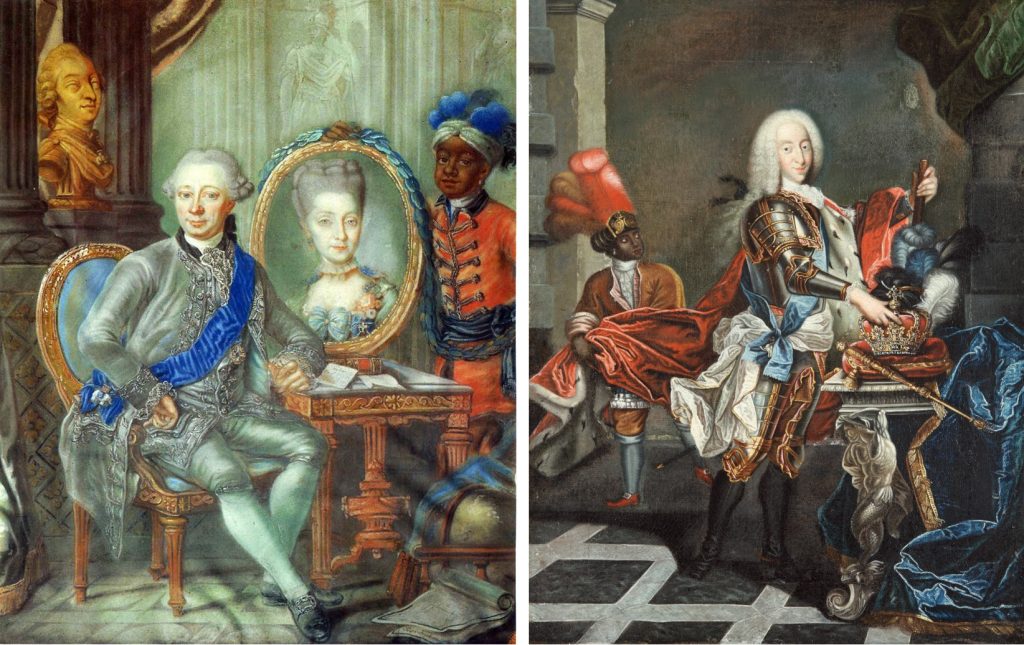Erstveröffentlichung dieses Textes in dem Blog
ZETT-UND-ZETT. Zeitgeschichte und Zeitgeschehen
Es ist der 18. Januar 1960. Auf dem Berliner Steinplatz, unweit des Bahnhof Zoo, versammeln sich nahezu 3.000 Studierende, Professorinnen und Professoren der Westberliner Hochschulen. Sie protestieren gegen Antisemitismus und Neonazismus, gegen die antisemitischen Zwischenfälle des Winters 1959/60 und gegen wiederamtierende “Ehemalige” – namentlich gegen Schröder, Globke und Oberländer: Karl Heinz Globke, maßgeblicher Kommentator der Nürnberger Rassegesetze und Kanzleramtschef unter Konrad Adenauer; Theodor Oberländer, der als sogenannter “Ostforscher” Denkschriften und Expertisen zur Legitimation der Zwangsumsiedlungen der Zivilbevölkerung in Osteuropa verfasst und es in der Regierung Adenauer zum Vertriebenenminister geschafft hatte; und Gerhard Schröder, Bundesinnenminister und seit der Vorlage des ersten Entwurfs der Notstandsgesetze im Jahre 1958 in der Kritik.
Unzählige Grabsteinen auf jüdischen Friedhöfen waren seit Weihnachten 1959 in ganz Westdeutschland geschändet, Synagogen mit Hakenkreuzen verunstaltet worden. Die Presse im In- und Ausland berichtete ausführlich und spätestens seit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess zwei Jahre zuvor war klar: Eine noch unbekannte Zahl von NS-Verbrechen war bislang ungeklärt und ungeahndet und ehemalige Funktionäre des NS-Regimes besetzen hohe Positionen in Regierung, Verwaltung und saßen auf den Richterstühlen. Für die junge Generation war sehr offensichtlich, was im Land im Argen lag. Der Protest am 18. Januar war öffentlicher Ausdruck dieses Unbehagens und zugleich eine Forderung nach einer Änderung der Verhältnisse.
Die Abwehr dieser Proteste folgte einer Struktur, die auch heute noch bekannt ist: die Akteure zu jung, zu unwissend, zu naiv. Die Gruppe, die sie repräsentierten zu klein. Von immerhin 20.000 Studierenden der Westberliner Hochschulen hatten nur 3.000 an dem Protest teilgenommen. Wer nicht still und betroffen der Opfer des Nationalsozialismus gedachte, sondern auf Missstände der Gegenwart hinwies und Namen nannte, der hatte zweifelsohne Hintermänner in der DDR, besorgte das Geschäft der Kommunisten. “Mit Anhängern des Nationalsozialismus werden wir in Berlin auch ohne kommunistische Hilfe fertig”, so der Westberliner Innensenator Joachim Lipschitz.
Nicht nur auf Demonstrationen und Protestmärschen wiesen die Studierenden auf die Missstände hin. In Petitionen an den Deutschen Bundestag und an die Länderparlamente im Jahr zuvor, hatten Studierende aus dem gesamten Bundesgebiet um Aufklärung über die Wiederverwendung ehemaliger NS-Justizjuristen im Justizdienst der Bundesrepublik gebeten. An der Freien Universität Berlin wurde die Petition von einer Unterschriftenaktion begleitet, zugleich stellten Studierende verschiedener Studentenverbände eine historisch-politische Ausstellung aus Akten der NS-Sondergerichte zusammen, um die Öffentlichkeit über die Vergangenheit ehemaliger NS-Richter und Staatsanwälte und ihre Tätigkeit in der Nachkriegsjustiz aufzuklären.
Die Unterschriftenaktion zur Stützung einer Petition an den Deutschen Bundestag begegnete an der Freien Universität zahlreichen Verboten. Sie durfte auf dem Gelände der Universität nicht durchgeführt werden, so sammelten die Studierenden Unterschriften vor der Mensa. Die Hochschulleitung der Freien Universität Berlin ging gegen den AStA vor und sprach diesem als Gremium der universitären Selbstverwaltung das Recht auf politische Meinungsäußerung ab.
Als die von den Studierenden erarbeitete Ausstellung im Februar 1960 unter dem Titel „Ungesühnte Nazijustiz“ in Westberlin präsentiert werden sollte, schlug den Studierenden heftige Gegenwehr entgegen. Insbesondere der damalige Justizsenator Valentin Kielinger und die ihm unterstehende Senatsverwaltung für Justiz brachten sich gegen die Studierenden in Stellung. Der Leitung der Westberliner Hochschulen wurde eindringlich geraten, den Studierenden keine Räume zur Verfügung zu stellen. Der Kultursenator rief die Westberliner Lehrer dazu auf, sich von der Ausstellung fern zu halten. Als schließlich die “Galerie Springer” den Studierenden Räume am Kurfürstendamm zur Verfügung stellte, wurde versucht, auf die Vermieterin des Galeristen Rudolf Springer einzuwirken, um auch dort die Ausstellung zu untersagen – dieses Mal jedoch ohne Erfolg. Die Ausstellung fand statt, am Kurfürstendamm 16, im Herzen Berlins und zog die Aufmerksamkeit der in Westberlin zahlreich vertretenen internationalen Presse auf sich.
Nun kann man sich diese Ausstellung, die von Studierenden mit denkbar geringen finanziellen Mitteln erstellt worden ist, nicht einfach genug vorstellen. Knapp Hundert einfache Aktenordner, gefüllt mit den Kopien von Verfahrensprotokollen der NS-Sondergerichte, dazu handschriftliche Anmerkungen und maschinenschriftliche Listen mit den Namen der beteiligten Juristen, ihrer ehemaligen Funktion und ihrem neuen Tätigkeitsort in der westdeutschen Justiz. Die Kopien hatte der Initiator der “Aktion Ungesühnte Nazijustiz”, der Westberliner Student Reinhard Strecker, aus Archiven aus Ostberlin, Warschau und Prag geholt, die Angaben wo in Westdeutschland und Westberlin die einzelnen an den teilweise haarsträubenden NS-Urteilen beteiligten Richter und Staatsanwälte wieder Dienst taten gemeinsam mit Mitstudierenden anhand der Handbücher der Justiz geprüft. Die so erarbeiteten Listen und Urteile wurden in Ausstellungen in Karlsruhe, Westberlin, Stuttgart, Kiel, Hamburg, München, Freiburg/Brsg., Göttingen, Tübingen und schließlich auch in Oxford, Leiden und Utrecht, sowie auf Einladung eines überparteilichen Komitees im britischen Unterhaus präsentiert.
In Zeiten von Whatsapp, Twitter, Facebook und Internet kann es nur erstaunen, welche Reichweite die Studierenden mit diesen einfachen Mitteln erreichten. Anfang der 1960er Jahre war es dieser Gruppe engagierter Studierender gelungen, mit einer Wanderausstellung zur NS-Justiz eine politische und öffentliche Debatte zum politischen und justizpolitischen Umgang mit wiederamtierenden ehemaligen NS-Justizjuristen anzuregen. Tageseitungen im In- und Ausland berichteten, ebenso Rundfunk und Fernsehen.
Die Gegenwehr war zunächst gewaltig. Den Studierenden wurde nach überkommenem Duktus ihre Jugend vorgeworfen und politische Naivität unterstellt. Sie seien entweder von Hintermännern aus Ostberlin gesteuert, oder leisteten den propagandistischen Zielen des Ostens Vorschub. Insbesondere die Westberliner Senatsverwaltung für Justiz unter ihrem Justizsenator Valentin Kielinger tat sich mit Angriffen gegen die Studierenden hervor. Insbesondere der Initiator Reinhard Strecker stand im Zentrum der Angriffe. Auch als der amtierende Generalbundesanwalt Max Güde schon längst die Authentizität der ausgestellten Unterlagen bestätigt hatte, wurde Justizsenator Kielinger nicht müde, die Studierenden und die Ausstellung in der Öffentlichkeit weiterhin als von “sowjetzonaler Seite inspiriert” zu diskreditieren.
Was als Aktion eines einzelnen Studenten, der sich aus reinem Interesse an der Thematik in das Thema “eingegraben” hatte begann, zog bald mehr und mehr Studierende an. Sie studierten in ihrer Freizeit Akten, stellten Material zusammen und organisierten Ausstellungen in der ganzen Republik. Es gelang ihnen, gegen alle Widerstände eine in der Bonner Republik gern unter der Decke gehaltene Thematik aufs politische Tapet zu bringen. Demonstrationen, öffentlicher Protest, Petitionen an Bundestag und Länderparlamente, Ausstellungsaktionen, ein umfangreiche Berichterstattung in den Medien und nationale und international Aufmerksamkeit. So in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, waren Bundestag und Bundesrat, Landesregierungen und -Parlamente gezwungen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Mit dem Paragraph 116 des Deutschen Richtergesetzes vom 8. September 1961 wurde schließlich eine Regelung geschaffen, das vorzeitige Ausscheiden politisch belasteter Justizjuristen zu ermöglichen. Auch dieses Gesetz ging sehr milde mit den ehemaligen NS-Juristen um, basierte auf Freiwilligkeit und ermöglichte das Ausscheiden bei vollen Bezügen, aber im Vergleich zum vorherigen Beschweigen und Verleugnen war es für die damalige Zeit ein großer Schritt. Den Ausgang nahm dies alles bei einigen Studierenden, die sich für ein ihnen am Herzen liegendes Thema engagierten und Politik beeinflussen wollten.
Die Kritiker des Studentenprotests hatten sich damals auf den Initiator Reinhard Strecker `eingeschossen´. Er hatte die Aktenkopien aus Ostberlin, Prag und Warschau besorgt, er war das Gesicht des Protests. Anerkennung für seine Verdienste hatte er über die Jahre nur in Form von Zuspruch seiner ehemaligen Kommilitonen erhalten, sowie durch die Würdigung der Aktion in der historiographischen Literatur. Der Kampf um eine offizielle Würdigung dauerte Jahre. Erst im August 2015, über 55 Jahre nach Eröffnung der Ausstellung “Ungesühnte Nazijustiz” in Berlin, wurde ihm in Anerkennung seiner Verdienste um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit das Bundesverdienstkreuz verliehen. Dennoch dauerte es noch bis zum April 2019, bis sich der amtierende Berliner Justizsenator Dirk Behrendt für die Angriffe seines Amtsvorgängers Valentin Kielinger gegen Reinhard Strecker und die “Aktion Ungesühnte Nazijustiz” entschuldigte. Im November 2019 wird wiederum die Stadt Karlsruhe, deren Stadtoberen im November 1959 noch gegen die Eröffnung der Ausstellung in der Karlsruher Stadthalle, dem ersten Ausstellungsort der Wanderausstellung, vorgegangen waren, die “Ungesühnten Nazijustiz” im Rahmen eines Symposiums ehren – Jahrzehnte nach der Aktion, nach Jahrzehnten, die Reinhard Strecker zwischen Zuspruch und Anfeindung erlebt hat.
Die Geschichte der “Aktion Ungesühnte Nazijustiz” macht nachdenklich und weckt Hoffnung. Sie stimmt nachdenklich, weil hier exemplarisch die Macht des Status Quo gegenüber progressiven Kräften deutlich wird, mit welchen Mitteln gegen Kritik und Protest vorgegangen wird. Sie weckt Hoffnung, weil sie anschaulich verdeutlicht, wie mit geringsten Mitteln die Öffentlichkeit aufgerüttelt und politische Verhältnisse geändert werden können. Es ist eine Thematik, die im Hinblick auf die aktuellen Proteste von Schülerinnen und Schülern für das ihnen am Herzen liegende Thema “Klimawandel” nicht zeitgemäßer sein kann. Wer den Wandel will, muss sich engagieren und wer sich engagiert, kann Politik beeinflussen und Themen setzen. Sie zeigt aber auch, dass die Argumente und Mittel gegen Jugendproteste sich wiederholen, sich die Strukturen der Abwehr immer gleichen. Die Argumente zielen immer auf die Jugend der Akteure ab, unterstellen Weltfremde, Naivität, vermuten Hintermänner und Strippenzieher. “Ihr seid ja nicht dabei gewesen!” – “Geht lieber in die Schule und lernt erst mal was ordentliches!” – “Ihr besorgt das Geschäft der Feinde der Demokratie!” Die Argumente der Abwehr gleichen sich. Doch wer die Strukturen der Abwehr erkennt, kann sich ihrer erwehren, und wer mit Überzeugung und Engagement auf politische und gesellschaftliche Defizite hinweist und den Wandel einfordert, der kann den Wandel erreichen. Das sind die großen Lehren der “Aktion Ungesühnte Nazijustiz”.
___________________________________________________________________
Nähere Informationen zur Aktion “Ungesühnte Nazijustiz” unter:
Stephan Glienke: Die Ausstellung “Ungesühnte Nazijustiz” (1959-1962). Zur Geschichte der Aufarbeitung nationalsozialistischer Justizverbrechen. Nomos-Verlag, Baden-Baden 2008.
Stephan Glienke: Studenten gegen Nazi-Richter. In: SPIEGEL ONLINE 24.02.2010
https://www.spiegel.de/einestages/nachkriegsskandal-a-948742.html
Erstveröffentlichung dieses Beitrags am 24.4.2019 in dem Blog “ZETT-UND-ZETT. Zeitgeschichte und Zeitgeschehen”, Direktlink:
Studentischer Protest 1960 – Die späte Anerkennung